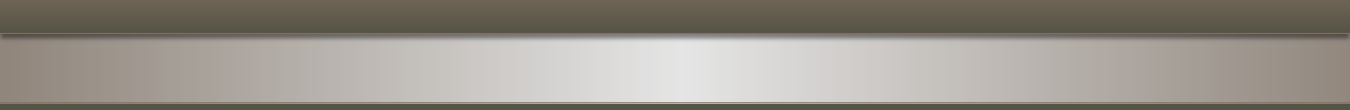
der jüdischen Bevölkerung aus dem Deutschen Reich
Leipzig -
Abfahrtsdatum: 13.07.42, Deportierte: 353 (nur Sudetenland, Gesamtstärke: ?)
Die Bezirksstelle Sudetenland der Reichsvereinigung mit Sitz in Aussig war bis zum November 1942 eigenständig und wurde dann als Verwaltungsstelle Aussig in die Bezirksstelle Mitteldeutschland mit Sitz in Leipzig eingegliedert. Zum Bereich der Bezirksstelle gehörte das 1938 eingegliederte Territorium ohne die mit der Schaffung des Reichsgaus Sudetenland am 14.4.39 an Schlesien, Bayern sowie die Reichsgaue Oberdonau und Niederdonau gegangenen Gebiete. Aus dem Sudetenland sind zwei größere Transporte in den "Osten" bekannt. Am 13.7.42 verließ ein erster Transport mit den jüngeren Juden aus den Regierungsbezirken Aussig und Eger das Sudetenland in Richtung Auschwitz, während die Menschen aus dem Regierungsbezirk Troppau am 27.2.43 abtransportiert wurden (siehe hier).
Durch den Bürgermeister von Teplitz-
Die Namen und Zahl der am 13.7. aus Teplitz-
In Aussig hatten sich die für den Transport eingeteilten Menschen auf dem Schulhof
am Langenmarckplatz einzufinden. Am Abend des 13.7. wurden sie einem Zug mit jüdischen
Menschen aus dem Sammellager Dlaschkowitz bei Leitmeritz angeschlossen. Die Zeugin
Olga Staňková erinnerte sich nach dem Krieg: "Am 13. Juli mussten alle aus dem Lager
zu Hause bleiben, niemand durfte auf Anordnung der Gestapo zur Arbeit. Gegen Mittag
mussten sich etwa 60 Personen (die Hochbetagten blieben) auf den Transport vorbereiten
und mit diesem Transport gingen auch meine Kinder -
Über den weiteren Verlauf der Deportation sind nur wenige Angaben bekannt. So gab
ein leitender Beamter der Gestapostelle Reichenberg nach dem Krieg zu Protokoll,
im Sommer 1942 gehört zu haben, dass auf dem Bahnhof in Reichenberg ein Zug mit Juden
halt gemacht habe, der weiter in Richtung Osten fuhr, angeblich nach Görlitz. Olga
Kronach sagte vor Gericht aus, dass sie in einem Gespräch mit einem Beamten erfahren
habe, dass ihre Mutter mit dem Transport nach Auschwitz deportiert worden sei [T.
Fedorovič, Theresienstädter Studien und Dokumente 2005, 276-
Die zeitlichen und örtlichen Begebenheiten sprechen dafür, dass der Transport aus dem Sudetenland einem Sammeltransport mit 338 Juden aus Süddeutschland, Luxemburg und Sachsen angeschlossen wurde, der laut Planung am 13.7. um 24 Uhr von Chemnitz abgefahren ist (siehe hier). Transportlisten für den Teiltransport aus dem Sudetenland sind nicht bekannt. Die Zahl der Deportierten kann jedoch aus der Statistik der Reichsvereinigung ermittelt werden. Diese verzeichnete im Juli 351 und, vermutlich in einer Nachmeldung, im August 2, insgesamt 353 Menschen. Der Sammeltransport hatte nach dem Anschluss der Juden aus dem Sudetenland demnach eine Stärke von 691 Menschen. Am 14.7. wurde dazu noch ein Teiltransport aus Oberschlesien zugeführt (siehe hier), so dass schließlich mehr als 900 Menschen in Auschwitz eingetroffen sind. Häftlingsnummern sind für diesen Deportationszug nicht vergeben worden, so dass davon ausgegangen werden muss, dass sämtliche Insassen nach der Ankunft ohne Selektion von Arbeitsfähigen ermordet wurden.
Ein Großteil der Namen der am 13.7.42 aus dem Sudetenland deportierten Menschen kann
aus den Unterlagen des Oberfinanzpräsidenten Dresden ermittelt werden, der für die
Verwaltung und Verwertung des jüdischen Vermögens in den Regierungsbezirken Aussig
und Eger zuständig war. Die Auswertung eines im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden
befindlichen Aktenverzeichnisses des OFP mit Angaben zum Namen und letzten Wohnort
der erfassten Personen lässt den Schluss zu, dass für die Deportierten des Transports
vom 13.7. Aktennummern von 582 bis 820 vergeben wurden [HStA Dresden, Bestand 11177/126].
Unter Berücksichtigung vereinzelter Unklarheiten lassen sich so die Namen von 330
Juden ermitteln, davon 279 aus dem Regierungsbezirk Aussig und 51 aus dem Regierungsbezirk
Eger. Allein 69 Deportierte kamen aus Teplitz-
Insgesamt 57 Orte im Sudetenland konnten ermittelt werden, aus denen Menschen am
13.7.42 deportiert wurden. Die nachfolgende Rekonstruktion ihrer Personendaten und
letzten Adressen erfolgte anhand von Meldekarten und weiteren Unterlagen, die im
Bestand von tschechischen Archiven überliefert sind, darunter im Nationalarchiv in
Prag, in den Gebietsarchiven von Litoměřice und Plzeň-























|
Orte, aus denen deportiert wurde | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altrohlau |
26 |
|
Hochpetsch |
3 |
|
Ringelshain |
1 |
|
Aussig |
34 |
|
Horschenz |
1 |
|
Rissut |
1 |
|
Bodenbach |
3 |
|
Karbitz |
1 |
|
Rumburg |
3 |
|
Böhm. Leipa |
5 |
|
Kaunowa |
2 |
|
Schelesen |
3 |
|
Bruch |
2 |
|
Komotau |
2 |
|
Schönwald |
24 |
|
Brüx |
8 |
|
Königsberg/Eger |
1 |
|
Simmer |
3 |
|
Buschullersdorf |
1 |
|
Leitmeritz |
2 |
|
Soborten |
7 |
|
Deutsch Zlatnik |
2 |
|
Liebshausen |
1 |
|
Swojetin |
1 |
|
Dlaschkowitz |
21 |
|
Lischnitz |
1 |
|
Teplitz- |
69 |
|
Drahomischl |
1 |
|
Lobositz |
2 |
|
Trautenau |
7 |
|
Edersgrün |
7 |
|
Mantau |
1 |
|
Trpist |
1 |
|
Eichwald |
1 |
|
Marienbad |
1 |
|
Tschernoschin |
1 |
|
Eidlitz |
1 |
|
Marschendorf |
1 |
|
Turn |
19 |
|
Eulau |
2 |
|
Mies |
1 |
|
Wlkov |
1 |
|
Gablonz |
17 |
|
Morchenstern |
1 |
|
Warnsdorf |
2 |
|
Gastorf |
2 |
|
Nieder Adersbach |
3 |
|
Wiesengrund |
3 |
|
Gibacht |
3 |
|
Noinitz |
2 |
|
Wisterschan |
1 |
|
Görkau |
2 |
|
Oberleutensdorf |
1 |
|
unbekannt |
23 |
|
Großtschernitz |
2 |
|
Reichenberg |
14 |
|
|
|
|
Hawran |
1 |
|
Reichstadt |
1 |
|
|
|
©TF 2022, mail(at)statistik-
| Jüdische Bevölkerung in Deutschland |
| Jüdische Bevölkerung in Berlin |
| Kultusvereinigungen und Bezirksstellen |
| Deportation der Juden aus Deutschland |
| Jüdische Auswanderung aus Deutschland |
| Volkszählung von 1933 |
| Volkszählung von 1939 |
| Volkszählung von 1946 |
| Bayern |
| Berlin |
| Brandenburg-Ostpreußen |
| Hessen/Hessen-Nassau |
| Mitteldeutschland |
| Nordwestdeutschland |
| Rheinland |
| Schlesien |
| Südwestdeutschland |
| Westfalen |
| I. Transport |
| II. Transport |
| III. Transport |
| IV. Transport |
| Brandenburg |
| Pommern/Ostpreußen |
| Sachsen/Thüringen |
| Sudetenland |
| 13.07.42 nach Auschwitz |
| 1943 nach Auschwitz |
| 13.11.-16.12.42 nach Theresienstadt |
| 1943-45 nach Theresienstadt |
| Baden |
| Pfalz |
| Saarland |